Wie gehen GLAM-Institutionen mit “problematischen Inhalten” um?
Institutionen im GLAM-Bereich adressieren problematische Inhalte auf verschiedene Weisen. Das Salzburg Museum kontextualisiert problematische Begriffe in der Online-Datenbank (neben anderen Maßnahmen) durch ein Glossar, das ständig erweitert wird und bietet dazu Disclaimer sowie die Option, das Foto nicht anzuzeigen. Ein Glossar bieten auch die Landessammlungen Niederösterreich.
Image+ kennzeichnet rassistische Begriffe typografisch (durchgestrichen, tiefgestellt), um den historischen Kontext zu wahren und die Weiterverbreitung zu unterbinden. Das Technische Museum Wien nimmt eindeutig rassistische Abbildungen offline und versieht andere mit einem Sensibilitätshinweis. Das Wien Museum trennt Original- und Präsentationstitel, um verletzende Begriffe weniger präsent zu zeigen, und ergänzt Schlagworte.
International setzt das DE-BIAS Projekt der Europeana auf ein KI-gestütztes Tool und ein mehrsprachiges Vokabular zur Erkennung und Kontextualisierung problematischer Begriffe, wobei Kritikerinnen und Kritiker die technische Reife der KI anzweifeln. Die Deutsche Digitale Bibliothek bietet ein Suchportal für Digitalisate aus kolonialen Kontexten, verzichtet aber auf die Abbildung menschlicher Überreste aus ethischen Gründen. Das niederländische Nationalmuseum der Weltkulturen nutzt ein Glossar, das als Orientierungshilfe dient und laufend überarbeitet wird. Das Humboldt Forum blendet Darstellungen aus, die Menschen entwürdigend zeigen oder rassistische Inhalte reproduzieren würden. Das Deutsche Hygiene-Museum trennt in seiner Sammlung zwischen Objekttitel und historischem Titel und setzt zudem auf eine Beschlagwortung.
Im Folgenden gehen wir näher auf die unterschiedlichen Herangehensweisen der jeweiligen Institutionen ein, wobei sowohl Institutionen innerhalb als auch außerhalb Österreichs betrachtet wurden.
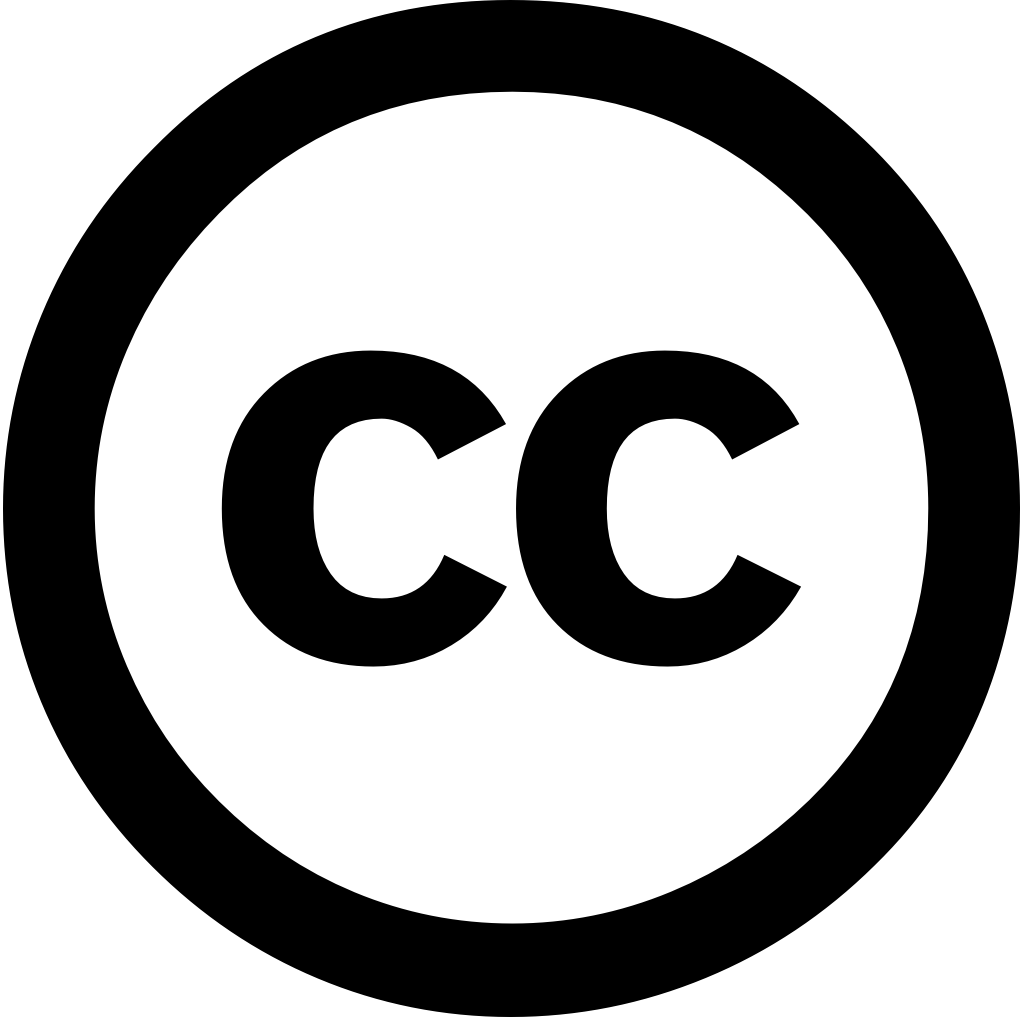 Die Inhalte dieser Seite sind unter CC0 bereitgestellt.
Die Inhalte dieser Seite sind unter CC0 bereitgestellt.
