Diskussion: Was verstehen wir unter “problematische” und “sensible” Inhalte? Welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung mit sich?
In Anlehnung an das Salzburg Museum können problematische Objekte oder sensible Inhalte als digitalisierte „Museumsobjekte, die in erster Linie Produkte oder Zeugnisse einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit darstellen“ verstanden werden.
Dazu zählen unter anderem Inhalte, die stereotypisieren, herabwürdigen, einem eurozentrischen, kolonialen Blick entspringen oder mit entsprechenden Begriffen kategorisiert wurden. Ebenso gehören Inhalte, die sich gegen aktuelle oder ehemalige marginalisierte Gruppen richten, sowie Begriffe der nationalistischen oder nationalsozialistischen Propaganda zu problematischen Inhalten.
Im Zuge der Digitalisierung dieser Sammlungsobjekte gibt es mehrere Aspekte, die berücksichtigt werden sollten. Die konkrete Umsetzung ist Teil von laufenden Debatten, die sich in etwa auf vier Bereiche konzentrieren:
- Die Frage, wie ethische Richtlinien für die Digitalisierung und Präsentation problematischer Inhalte aussehen sollten.
- Diskussionen darüber, wie der Zugang zu digitalisierten problematischen Inhalten geregelt werden sollte.
- Die Debatte, wie digitalisierte problematische Inhalte altersgerecht für Bildungszwecke genutzt werden können, ohne zu verharmlosen, zu glorifizieren oder zu traumatisieren.
- Die Diskussion, wie neue Technologien wie KI und XR (Extended Reality, z. B. Augmented Reality) für eine angemessene Präsentation und Kontextualisierung problematischer Inhalte genutzt werden können.
Digitalisierung muss unter Berücksichtigung geltender rechtlicher Rahmenbedingungen erfolgen, insbesondere in Bezug auf das Strafrecht, auf das Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte. Weiterhin sind eine wissenschaftlich fundierte Einordnung des Objekts sowie die Abwägung unterschiedlicher Interessen empfehlenswert.
Durch historische und kulturelle Kontextualisierung können Missverständnisse vermieden werden. Eine Kontextualisierung ermöglicht zudem die kritische Auseinandersetzung mit dem Objekt und seiner Sammlungsgeschichte.
Die Entscheidung, ob und welche problematischen Inhalte digitalisiert werden sollen, erfordert eine sorgfältige ethische Abwägung. Dabei gilt es, zwischen mehreren Interessen abzuwägen: Einerseits soll Kulturerbe für Bildung und Forschung zugänglich gemacht werden, andererseits muss vor missbräuchlicher Verwendung geschützt werden. Institutionen sind ebenso angehalten, bewusst daran zu arbeiten, strukturelle Diskriminierung, etwa durch abwertende Begriffe in den Katalogen, zu vermeiden.
Dazu schreibt Ciraj Rassool, Professor für Geschichte an der University of the Western Cape (UWC), wo er auch das African Programme der Museum and Heritage Studies leitet:
There is pressure to hold on to historical records in order to preserve the history and use of notions such as tribe and race in museum labels... The desire to stop the perpetuation of administrative racism is met with the desire to document this history.
Die Dokumentation dieser Geschichte hängt eng mit dem Bedürfnis nach kollektiver Erinnerung zusammen. Infolgedessen könnte auch argumentiert werden, dass die Nicht-Veröffentlichung von digitalisierten Artefakten negative Folgen für eine Gesellschaft aufweist. Die möglichen Folgen für das kollektive Gedächtnis bringen Studierende in einem Podcast der Universität Paderborn (2022) im Zuge der Restitutionsdebatte am Beispiel des Humboldt Forum in Berlin wie folgt auf den Punkt:
Durch die Wegnahme eines Artefakts wird also nicht nur ein Gegenstand geraubt, sondern auch eine Möglichkeit für das Kollektiv, sich zu erinnern und die Situation gegebenenfalls zu verarbeiten. Es stellt sich die Frage, was passiert, wenn eine kollektive Erinnerung und die damit verbundene Verarbeitung nicht möglich ist. Die gesamte gemeinsame Geschichte der Kolonialzeit und die damit verbundenen Konsequenzen auf den heutigen Umgang im interkulturellen Austausch bleiben somit unzureichend reflektiert.
Kuratorinnen und Kuratoren sowie betroffene Institutionen befinden sich in ihrem Bemühen oftmals in einem Spannungsfeld zwischen der generellen Öffnung von Museen und der Einladung zur Partizipation einerseits und der Sorge um mögliche schwierige Präsentationsformen der Objekte, so Chiara Zuanni, Associate Professor für Digital Humanities an der Karl-Franzens-Universität Graz. Sie schreibt in einem Gastbeitrag für Der Standard (2021):
Oft ist es eine Gratwanderung, Kontroversen in der Öffentlichkeit zu bewältigen, aber gleichzeitig zur Diskussion anzuregen. Gleichzeitig sollte dabei noch der Auftrag der Museen aufrechterhalten werden und materielles und immaterielles Erbe zum Zwecke der Bildung, des Studiums und des Vergnügens bewahrt und vermittelt werden.
Margit Berner, Anthropologin und Kuratorin am Naturhistorischen Museum Wien, merkt zur Debatte an, dass es wichtig sei, bereits von Beginn an zu klären, warum ein Objekt digitalisiert werden sollte: Was ist die Aufgabe dieses Digitalisats? Welche (Langzeit-)Folgen könnten seine Digitalisierung für das Museum, aber auch für eine Gesellschaft mit sich bringen? Wem sollte der Zugang zu diesem Objekt ermöglicht werden? Bei der Beantwortung seien insbesondere auch kulturelle Unterschiede und Besonderheiten in den Überlegungen, wie Bilder auf Rezipient*innen wirken, einzubeziehen.
So müssten auch betroffene Communities oder die Interessen von Angehörigen oder Nachfahren an der Debatte teilhaben können. Bei sensiblen Objekten, wie etwa Fotos von Kriegsgefangenen oder Scans von menschlichen Überresten, sollte – falls die Digitalisierung überhaupt als sinnvoll erachtet wird – von der öffentlichen Darstellung von Bildern abgesehen und stattdessen lediglich die Objektdaten gezeigt werden. In manchen Fällen könnte auch eine stellvertretende Visualisierung (Zeichnung) oder ein Symbolbild nützlich sein.
Die laufenden Debatten über diese Fragen zeigen, dass die Digitalisierung problematischer Inhalte im Kulturerbe eine sorgfältige Abwägung zwischen Zugänglichkeit, Kontextualisierung und ethischen Überlegungen erfordert. Es bedarf weiterer Forschung und Diskussion, um Best Practices in diesem sensiblen Bereich zu entwickeln.
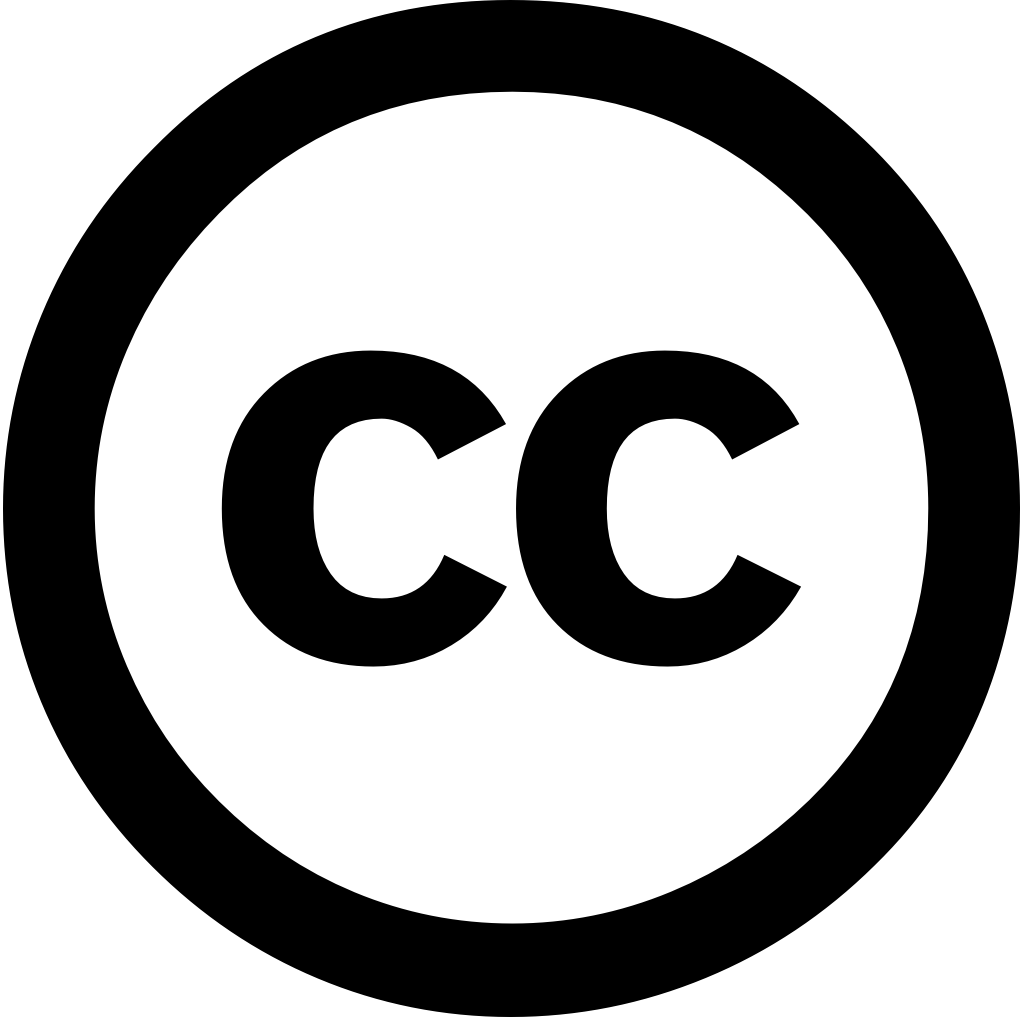 Die Inhalte dieser Seite sind unter CC0 bereitgestellt.
Die Inhalte dieser Seite sind unter CC0 bereitgestellt.
