Praxisbeispiele international
Im folgenden Abschnitt werden Beispiele von österreichischen Institutionen und Projekten in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Dabei handelt es sich um keine vollständige Auflistung. Gerne können Sie uns kontaktieren und wir nehmen Ihre Institution als Praxisbeispiel auf.
Deutsche Digitale Bibliothek: Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten
Im November 2021 ging das Suchportal „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ online. „Das Angebot richtet sich vorrangig an Personen und Organisationen aus Herkunftsstaaten und -gesellschaften, Vertreter*innen diasporischer Gemeinschaften und Akteur*innen der Zivilgesellschaft. Sie sollen die Möglichkeit haben, ihrem reichen materiellen Kulturerbe zu begegnen. Forschenden weltweit bietet das Portal die Möglichkeit, kolonialzeitliche Erwerbungskontexte nachzuvollziehen“, heißt es auf der Webseite. Dabei werden allerdings aus ethischen Gründen keine Abbildungen von menschlichen Überresten gezeigt. Als Grund dafür gibt die DDB an, dass eine erneute Veröffentlichung die Betroffenen objektiviere bzw. entmenschliche.
Für die Objektsuche wird darauf hingewiesen, dass in den Filtern nur Werte angezeigt werden, die mit einem kontrollierten Vokabular verknüpft sind, um eine eindeutige Identifikation zu ermöglichen. In den FAQ heißt es:
Da nicht alle Informationen zu den Sammlungsgegenständen mit kontrollierten Vokabularen verknüpft sind oder die Angaben in den Datensätzen ganz fehlen, können im Portal mehr Sammlungsgegenstände zu finden sein, als in den Suchfiltern angezeigt werden. Über den Suchschlitz können Sie nach allen Begriffen suchen, so dass es hier in der Regel mehr Treffer gibt als in den Suchfiltern.
Folgende Vokabulare werden für die unterschiedlichen Filter ausgewertet:
- "Herkunftsgesellschaft" und "Objekttyp" Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek, Wikidata, Art and Architecture Thesaurus (zuletzt eingesehen am 10.03.2025)
- "Personen/Organisationen" und "Aktueller Standort": Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek (zuletzt eingesehen am 10.03.2025)
- "Orte": Wikidata, GeoNames, Thesaurus of Geographic Names, Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek (zuletzt eingesehen am 10.03.2025)
Deutsches Hygiene-Museum, Dresden
2018 machte das Deutsche Hygiene-Museum Schlagzeilen mit einer Sonderausstellung zum Thema “Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen”. Die 1912 gegründete Institution wurde mit ihrer frühen Auseinandersetzung mit Eugenik als Plattform für nationalsozialistische Propaganda genutzt und setzt sich aufgrund seiner belasteten Vergangenheit intensiv mit dem rassistischen Erbe des Museums auseinander.
(Vgl.: Täter*inenspuren – Dresden, Deutsches Hygiene-Museum: Rassistische Propaganda, Station 1 der Tour Mahngang 2025 Rassismus per Gesetz, zuletzt eingesehen, am 12.03.2025.)
In einem Interview mit Amnesty International erklärt Kuratorin und Projektleiterin Susanne Wernsing den Zugang, wie in der Ausstellung mit rassischen Objekten umgegangen wurde:
’Das, was ich bestreite, die Existenz von menschlichen Rassen, muss ich ständig zeigen' – weil die historischen Plakate, Bücher, Broschüren genau das behaupten. ‘Wir arbeiten mit Exponaten, die geschaffen wurden, die Idee menschlicher 'Rassen’ in die Köpfe der Menschen zu bringen. Die Kunst, die uns gelingen muss, ist, die Objekte so zu präsentieren, dass ihre Gemachtheit deutlich wird.’ Deshalb werden zum Beispiel die rassistischen Plakate der dreißiger Jahre auf Arbeitstischen gezeigt, als Untersuchungsgegenstand markiert. An den Wänden hängen hingegen Werke der klassischen Moderne, die damals als ‘entartet’ diffamiert wurden.
Was in der musealen Präsentation und Vermittlung möglich ist, stellt digitale Sammlungen allerdings vor die Herausforderung, dass eine derartige Kontextualisierung (bisher) lediglich textbasiert geschieht. Zudem ist dieser Kontext zumeist erst in der Detailanzeige der einzelnen Objekte ersichtlich, in der Übersicht von Suchresultaten ist etwa ein Bild nicht als problematischer Inhalt ersichtlich. In seiner Online-Sammlung setzt das Deutsche Hygiene-Museum seinen Anspruch mit der Trennung von "Objekttitel" und "Historischem Titel" sowie in Form einer kontextualisierenden Beschlagwortung um.
Beispiel:
Objekttitel: Figur, Afrikanerin
Historischer Titel: “Schuli-Negerin”
Schlagworte: Rassismus, Kolonialismus
Objekt in der Online-Sammlung, zuletzt eingesehen am 12.03.2025
Europeana: DE-BIAS Projekt
Das Projekt DE-BIAS, das vom Programm Digitales Europa der Europäischen Union kofinanziert wird, zielt darauf ab, einen integrativeren und respektvolleren Ansatz zur Beschreibung von digitalen Sammlungen des kulturellen Erbes zu fördern und in Kooperation mit marginalisierten Communities mehr Partizipation und Inklusion zu fördern. Im Fokus stehen die drei Hauptthemen: Migration und Kolonialgeschichte, Geschlecht und sexuelle Identität sowie ethnische und ethnisch-religiöse Identität.
Zu den wichtigsten Ergebnissen des Projekts zählen:
Entwicklung eines KI-gestützten Tools: DE-BIAS hat ein Tool entwickelt, das automatisch problematische Begriffe in Metadaten zum kulturellen Erbe erkennt und kontextbezogene Informationen über deren Hintergrund liefert.
Erstellung eines mehrsprachigen Vokabulars: Im Rahmen des Projekts wurde ein Vokabular entwickelt, das 700 Wörter in fünf Sprachen umfasst und anstößige Begriffe mit Kontextinformationen und Vorschlägen für geeignete Begriffe kombiniert.
Capacity-Building: Im Rahmen des Projekts wurden Ressourcen und Materialien entwickelt, die Fachleute aus dem Bereich des kulturellen Erbes dabei unterstützen, Vorurteile in ihren Sammlungen zu verstehen, zu analysieren und zu bekämpfen.
Das DE-BIAS-Tool wird in die Europeana-Website integriert und für die Nutzung durch einzelne Kulturerbe-Institutionen zur Verfügung gestellt. Durch die Online-Wissensdatenbank und die Kurse zur Schulung von Ausbilder:innen soll DE-BIAS die langfristige Übernahme seiner Ergebnisse durch den Kulturerbe-Sektor gewährleisten, heißt es auf der Webseite.
Kritikpunkte und offene Fragen:
Während die automatisierte Prüfung von Daten Vorteile bzw. Erleichterung bringe, bezweifeln Kritiker:innen des Projekts die technische Reife der KI für diesen Anwendungsfall. Auch sei die Mehrsprachigkeit nach wie vor ein Grund für Probleme. Fraglich ist zudem, ob eine automatisierte Beschreibung die wissenschaftlich fundierte Kontextualisierung seitens Kurator:innen ersetzen kann.
Das Projektteam gibt wiederum zu bedenken, dass das Tool auch strukturelle Schwachstellen im Kulturerbe-Sektor offenbart. So habe der Bottom-up-Ansatz gezeigt, dass oftmals die Beschreibungen der Objekte bereits von Personen verfasst werden, die zu wenig informiert oder voreingenommen sind. Mängel in der Repräsentation, aber auch sprachliche Mängel, führen in der Folge zu mangelhaften Datensätzen. Im Projektbericht wird ebenso darauf hingewiesen, dass Tools und Vokabulare allein nicht ausreichen:
Unfortunately this challenge cannot be taken up with a tool and vocabulary designed to merely detect bias and contentiousness based on occurrences of terms in existing metadata, but requires a more holistic rethinking of the approach to describing cultural heritage collections.
Nationalmuseum der Weltkulturen (NL): Glossar
Das Nationalmuseum der Weltkulturen veröffentlichte 2018 die Publikation "Words Matter" (Niederländische Version / englischsprachige Übersetzung), in der sich Expertinnen und Experten mit der Verwendung problematischer Begriffe auseinandersetzten. Ihren Ansatz erklären sie wie folgt:
Die Tatsache, dass Wörter und Sprachnormen einem ständigen Wandel unterliegen, kann bei denjenigen, die an diese Wörter gewöhnt sind, Verwirrung und Unbehagen hervorrufen; dies gilt auch für die Museen. Aber die Gesellschaft ändert sich, und die Sprache ändert sich mit ihr. Unsere Objekte mögen zeitlos sein, aber die Art und Weise, wie wir über sie sprechen, ist es nicht.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber geben zu bedenken, dass es sich bei einer Begriffsliste wie dieser um einen kontinuierlichen Prozess handelt, der laufend überarbeitet und ergänzt werden müsse. Die vorliegende Publikation sei als Orientierungshilfe gedacht und enthält „eine Liste von Wörtern, eine Erklärung, warum ein bestimmtes Wort als sensibel oder umstritten gilt, sowie alternative Begriffe, die in unserer Museumspraxis verwendet werden können.“(Ebda)
Humboldt Forum, Berlin
Obwohl das Humboldt-Forum das Ziel verfolgt, sämtliche Exponate, die vor Ort zu besichtigen sind, auch in der Online-Sammlung verfügbar zu machen, werden bestimmte Fotografien davon ausgenommen. In ihren FAQ erklärt die Institution ihre Herangehensweise wie folgt:
Als Grundlage für die Präsentation einer Abbildung eines ausgestellten Objekts muss neben der Digitalisierung auch die rechtliche Freigabe erfolgt sein. Wir bemühen uns laufend um Aktualisierungen und die vollständige Wiedergabe aller objektrelevanten Angaben und Abbildungen. Sollte noch kein Bild zu sehen sein, lohnt sich ein erneuter digitaler Besuch zu einem späteren Zeitpunkt. Wir weisen darauf hin, dass bestimmte Fotografien bewusst nicht auf Sammlungen Online gezeigt werden. Zum einen betrifft dies Abbildungen, die Menschen in einer entwürdigenden und verletzenden Weise darstellen. Dies dient auch dazu, rassistische und anderweitig diskriminierende Inhalte, die auf diesen Fotografien zu sehen sind, nicht zu reproduzieren. Zum anderen kann Sammlungen Online Bilder enthalten, die zunächst nur unter Vorbehalt veröffentlicht werden.
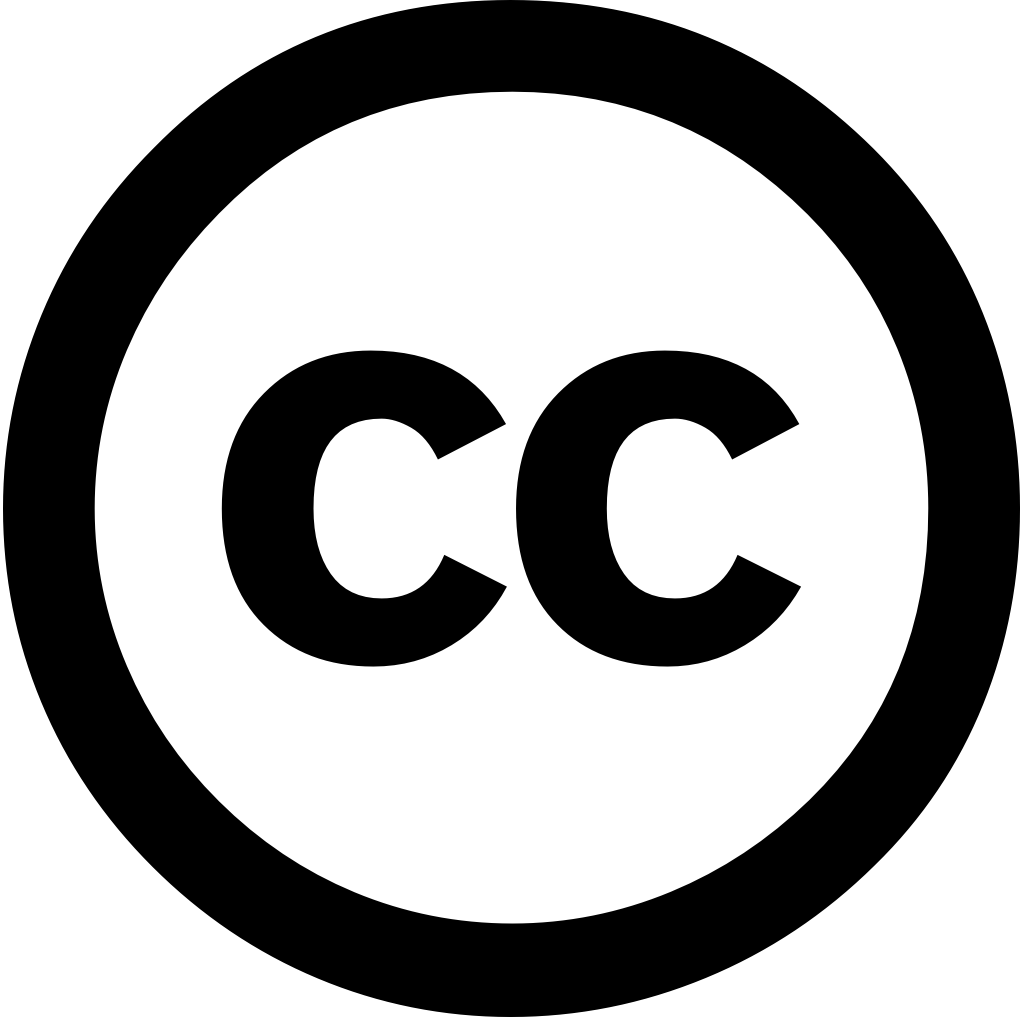 Die Inhalte dieser Seite sind unter CC0 bereitgestellt.
Die Inhalte dieser Seite sind unter CC0 bereitgestellt.
